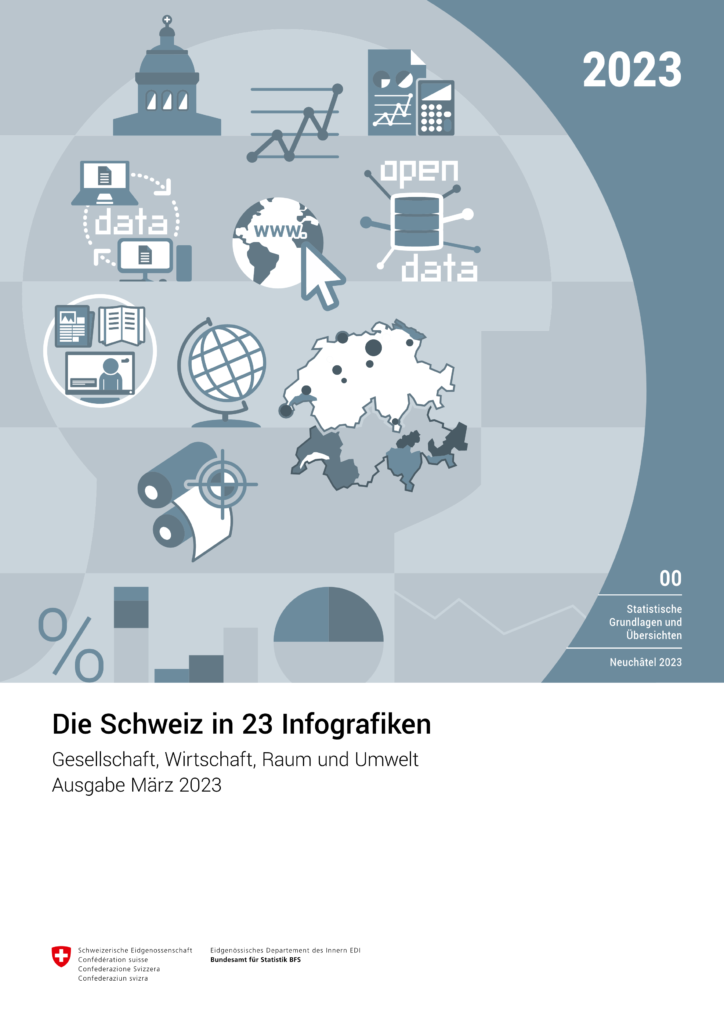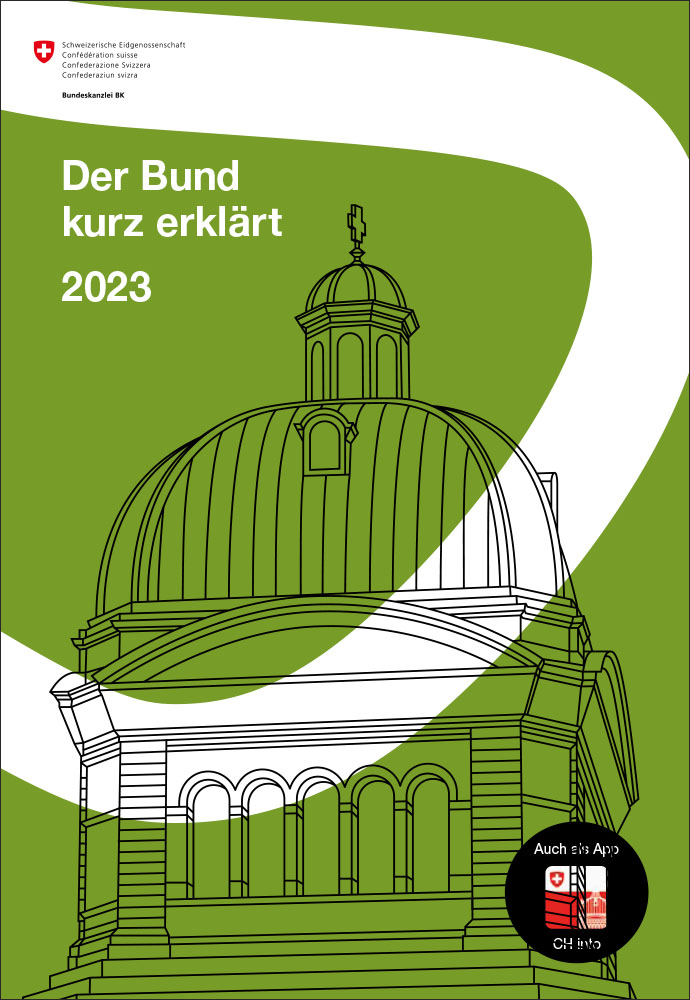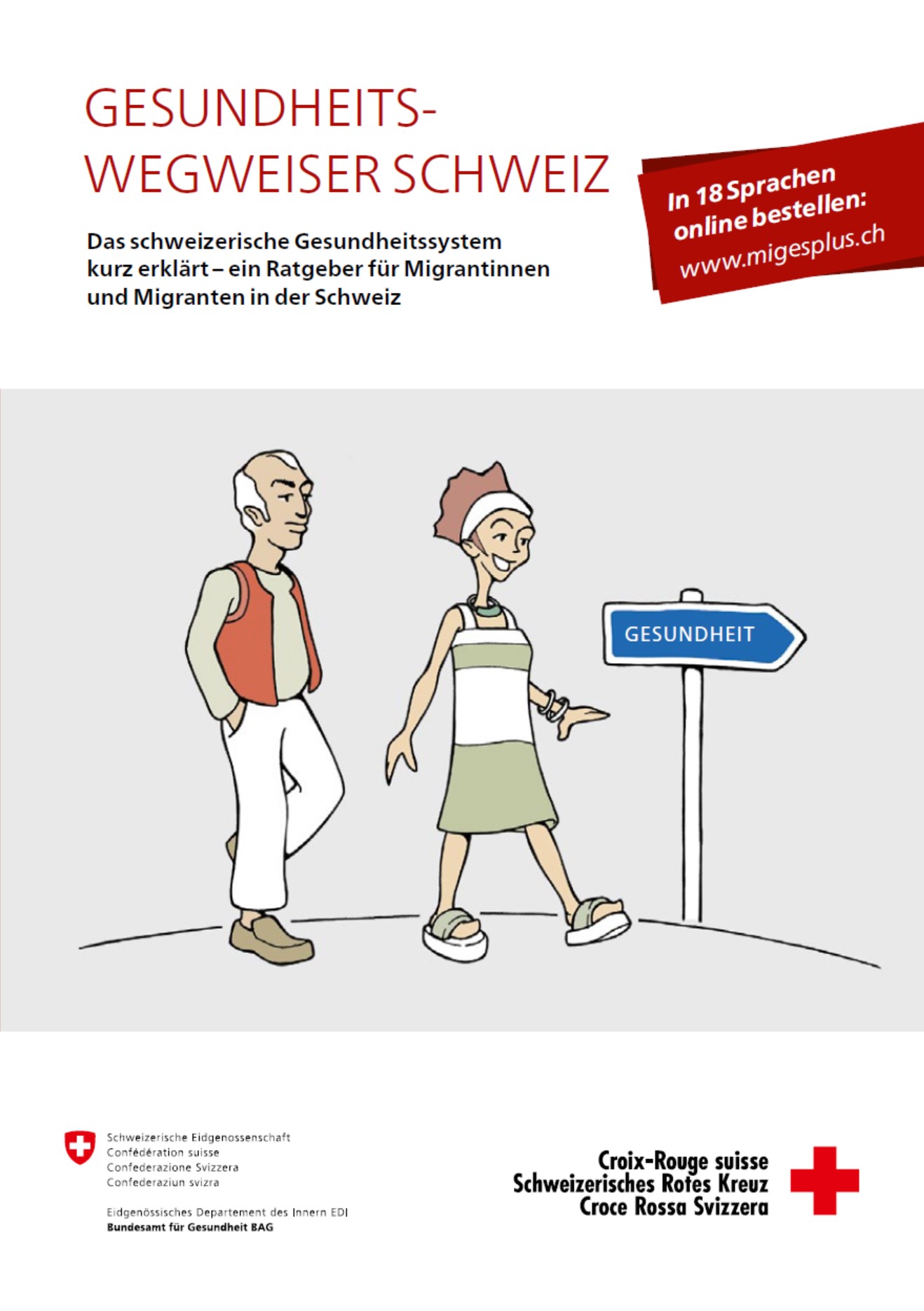Wir informieren Interessierte, Behörden, Organisation, Fachpersonen, Medien, Arbeitgebende, Vereine, Religionsgruppen, etc. über Themen rund um Migration und Integration.
Wir koordinieren und vernetzen Integrationsangebote innerhalb der Region, um Synergien zu nutzen sowie Menschen und Ideen zusammenzubringen.
Wir beraten Migrations- und Nonprofit-Organisationen bei der Planung und Durchführung von Projekten und initiativen im Integrationsbereich. Wir führen selbst Projekte und Veranstaltungen durch.
Wenn Sie mehr wissen wollen:
Tel. 061 206 92 31 / 32 oder Mail an info@ggg-migration.ch.

Informationen des Kantons Basel-Stadt
Links
Soziales Basel
Treffpunkte für Migrant/innen
sozialesbasel.ch
Beratungsstelle für Asylsuchende
Ausländerdienst Baselland
Stopp Rassismus
Inforel (religiöse Gemeinschaften)
GGG Basel
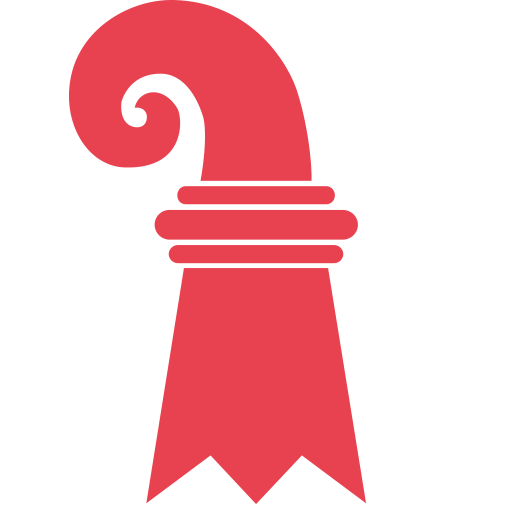
Kanton
Fachstelle Diversität + Antirassismus BS
Projektförderung BS
Sprachförderung BS
Deutschkurse Webportal
Bevölkerungsdienste BS
Fachbereich Integration BL
Kantonale Integrations-Programme (KIP)
Schweiz
Staatssekretariat für Migration (SEM)
Eidgenössische Migrationskommission
Eidgenössiche Kommission gegen Rassismus
Konferenz der Fachstellen für Integration (KoFI)
Ansprechstellen in anderen Kantonen
Fachstelle Zwangsheirat
Grundlagen
Schweizer Integrationspolitik
Basler Integrationsstrategie
Integrationsgesetz und Verordnung Basel-Stadt
Integrationsindikatoren Basel-Stadt
Ziel von Integration „ist ein gedeihliches und auf gegenseitigem Respekt beruhendes Zusammenleben der Einheimischen und der Migrationsbevölkerung. … Dieser soll ermöglicht werden, am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben teilzuhaben.“
Integrationsgesetz Basel-Stadt